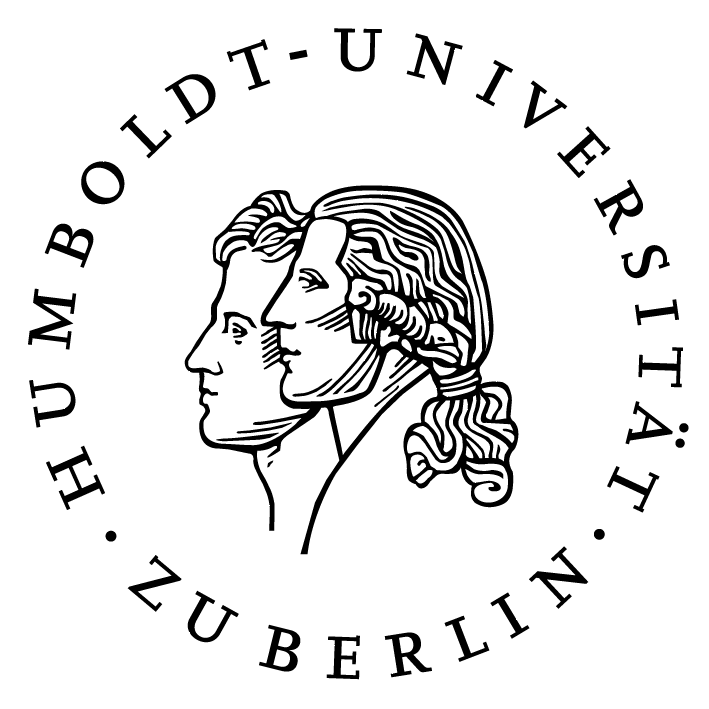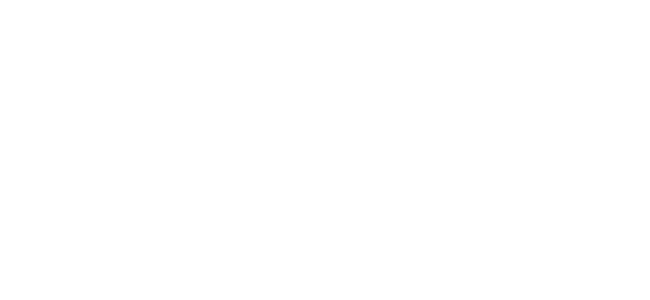Interaktive Exploration bio-bibliographischer Daten – Projektpräsentation auf der Konferenz „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum“
Auf der Konferenz „Digital Humanities im deutschsprachigen Raum 2025“ (Bielefeld, 3. – 7. März 2025) stellte Axelle Lecroq im Rahmen einer Posterpräsentation den aktuellen Stand der Explorationsoberfläche zur Erschließung der im Projekt erhobenen bio-bibliographischen Daten vor.
(mehr …)Helga M. Nowak — eine deutsch-isländische Autorin im Spiegel ihrer Zeit
Welche Beziehung bestand zwischen der isländischen Staatsbürgerin María Karlsdóttir und dem Institut für Literatur „Johannes R. Becher“ (IfL) in Leipzig, welches Zeit seines Bestehens die einzige universitäre Ausbildungsstätte für Schriftsteller im deutschsprachigen Raum gewesen ist? Wer war diese Frau, die zeitweise u. a. auch Maria Vigfússon hieß? Und welche Rolle spielte das Ministerium für Staatssicherheit der DDR (MfS) dabei?
Am 8. September 1935 ist in Berlin ein Mädchen geboren worden, das den Namen Helga Maria erhielt und von ihren Eltern sogleich zur Adoption freigegeben wurde. Die Kinderjahre während der Zeit des Nationalsozialismus verbrachte es bei seinen Adoptiveltern Karl und Charlotte Nowak. Helga Maria Nowak besuchte ab 1941 die Volksschule, zwischen 1950 und 1954 die Oberschule[1] und trat am Todestag Josef Stalins in die SED ein.[2] Nach dem Abitur zog sie nach Leipzig und begann dort ein Studium der Journalistik. Während dieser sozialistischen Ausbildung wurde Nowak zur „dóttur hins nýja þjóðskipulags í Austur-Þýskalandi“[3] – Tochter der neuen Gesellschaftsordnung in der DDR – doch geriet sie zunehmend in einen Konflikt mit dem Sozialismus, der dazu führte, dass sie 1957 aus politischen Gründen exmatrikuliert wurde.
Mit ihrem damaligen Verlobten Eysteinn Þorvaldsson (23.6.1932–8.9.2020[4]) beging Nowak Ende 1957 sog. Republikflucht, zog aus der DDR nach Island, wo sie dann verschiedenen Hilfsarbeiten, so beispielsweise in einer fischverarbeitenden Fabrik sowie in einer Wollwarenweberei, nachging. Gelegentlich findet sich die Mutmaßung, dass Helga M. Nowak und Eysteinn Þorvaldsson ein gemeinsames Kind gehabt haben sollen.[5] Diese Behauptung lässt sich aber nicht bestätigen.[6]
Schließlich kam Nowak 1958 wieder in die DDR zurück. Hier lernte sie auch ihren späteren Ehemann, ebenfalls einen Isländer, kennen.[7] Am 1. Juli 1960 heiratete sie Þór Vigfússon (2.4.1936–5.5.2013[8]) in der DDR.[9] 1961 – in Berlin war gerade die Mauer gebaut worden – verzog das Paar nach Island. Dort gab sie ihr erstes Buch im Selbstverlag heraus.[10] Außerdem erlernte sie die isländische Sprache. In der DDR wurden ihre Werke übrigens nicht veröffentlicht.[11] Ihre einzige Tochter wurde 1962 in der Ehe mit Þór Vigfússon geboren.[12]
Im Jahre 1965 kehrte Helga Maria Vigfússon abermals in die DDR zurück. In Leipzig nahm sie am 4. September jenen Jahres ein Studium am IfL auf, von dem sie schon am 14. Dezember aus politischen Gründen wieder exmatrikuliert wurde.[13] Die Schriftsteller-Studentin war in ein Spannungsfeld zwischen ihren literarischen Idealen und den politischen Ansprüchen der DDR geraten. Bemerkenswert ist dabei auch die Tatsache, dass Helga M. Nowak, verheiratete Vigfússon, sich ihre sämtlichen personenbezogenen Dokumente vom IfL aushändigen ließ,[14] sodass es heute wohl nur noch an Hand von Zeitzeugeninterviews möglich ist, ihre dortige Studienzeit in Einzelheiten zu rekonstruieren. Zu Nowaks Kommilitonen zählten u. a. Karl Wurzberger, Horst-Ulrich Semmler, Rosemarie Fret und Karin Raischies.[15]
Anfang 1966 stellte sie sodann einen Ausreiseantrag und verließ endgültig die DDR nach Island. Durch ihre Ansichten war sie zu einer unerwünschten Person in der DDR geworden. Per Gesetzesbeschluss des Alþingi (isländischen Parlaments) über die Gewährung der isländischen Staatsbürgerschaft wurde Helga Maria Vigfússon am 30. April 1966 die isländische Staatsangehörigkeit gewährt,[16] weil sie schon zuvor drei Jahre lang mit ihrem isländischen Ehemann in Island gelebt hatte.[17] In diesem Zusammenhang nahm sie ihren isländischen Namen an. Bis heute sind in Island Patronyme, also an Stelle eines Familiennamens vom Rufnamen des Vaters abgeleitete Abstammungsnamen, üblich. Helga Maria Vigfússon war (Adoptiv-)Tochter von Karl Nowak, sodass ihr islandisierter Name María Karlsdóttir (Karls Tochter) wurde. Gleichzeitig hat sie die Staatsbürgerschaft der DDR verloren; jene der BRD hingegen nie beantragt.[18]
Doch auch auf der Insel im Nordatlantik blieb ein länger währendes familiäres Glück verwehrt. Die Ehe wurde 1968 geschieden[19] und María Karlsdóttir verzog in die Bundesrepublik Deutschland. Regelmäßig kehrte sie besuchsweise nach Island zurück. Im Dezember 1982 gab sie der Zeitschrift „Helgarpósturinn“ ein Interview und berichtete über Schwierigkeiten ostdeutscher Autoren in der BRD, insbesondere den harten Konkurrenzkampf.[20]
Nach der politischen Wende 1989/90 in der DDR wurde sie von ihrer Vergangenheit eingeholt. In einem Offenen Brief im „Spiegel“ gestand sie ein, für das MfS tätig gewesen zu sein und ausländische Studenten bespitzelt zu haben.[21] Tatsächlich füllt der Umfang der Stasi-Akte zu Helga M. Nowak mit einer Laufzeit von 1957 bis 1989 einen ganzen Aktenordner. Darin findet sich auch ihre Verpflichtungserklärung von 1957.[22] Vergessen werden darf hierbei allerdings nicht, dass auch ihr (späterer) Ehemann Þór Vigfússon seinerseits im Auftrag der Kommunistischen Partei Islands mutmaßlich Spionagetätigkeiten in der DDR begangen haben soll.[23]
Die neuen Zeiten brachten noch eine weitere Schwierigkeit für María Karlsdóttir mit sich. Als isländische Staatsbürgerin, die nach 1990 nie ihren dauerhaften Wohnsitz in Deutschland bestätigen ließ, hatte sie vorerst auch kein Anrecht auf Sozialleistungen.[24] Ihre literarischen Werke indessen zeugen vom Beherrschen der deutschen Sprache – jener Voraussetzung, welche es seit einer Gesetzesänderung auch ausländischen Staatsangehörigen in Deutschland erlaubt, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen.[25]
Helga M. Nowak alias María Karlsdóttir verstarb am 24. Dezember 2013 in Rüdersdorf bei Berlin.
Quellenverzeichnis:
Archivquellen:
Bundesarchiv, BA MfS AIM 916/61 Bd. 1.
Bundesarchiv, BA MfS AP 1382/92.
Forschungsplattform Literarisches Feld DDR: Helga M. Novak.
RÚV, DB9213. Samtímaskáldkonur, 1.10.1985.
RÚV, 015268-0010-01. Orð um bækur, 9.12.2012.
Sammlung Jacob, Berlin: Helga M. Nowak.
Þjóðskrá Íslands, Auskunft vom 31.1.2024.
Gedruckte Quellen:
Alþingi: Lög 18/1966 um veitingu ríkisborgararéttar. 9. mál, nefndarálit 507, 19.4.1966.
Alþingi: Lög 18/1966 um veitingu ríkisborgararéttar. 9. mál, lagafrumvarp 663, 30.4.1966.
Morgunblaðið: Minningar, 18.5.2013, S. 32.
Morgunblaðið: Minningar, 22.9.2020, S. 21f.
[O.V.]: Þýzk stúlka, búsett á Íslandi. In: Morgunblaðið, 14.12.1967, S. 17.
[O.V.]: Þýsk skáldkona segist hafa unnið fyrir Stasi. In: Morgunblaðið, 7.11.1991, S. 20.
[O.V.]: Flýði land ásamt Íslendingi sem njósnað hafði um systurflokkinn. In: Morgunblaðið, 12.11.1991, S. 27.
[O.V.]: Íslenskir námsmenn undir eftirlit Stasi í Leipzig. In: Tíminn, 9.11.1991, S. 26.
Tanneberger, Horst/ Hillich, Reinhard: Literatur in der SBZ/DDR. Bibliographische Annalen 1945-1990. Begründet von Herbert Jacob. Berlin 2021.
Thoroddsen, Ásdís: Ekki hrædd lengur. In: Helgarpósturinn, 22.12.1982, S. 6.
Autorin: Marianne Jacob
[1] Vgl. Sammlung Jacob: Helga M. Nowak.
[2] Vgl. Thoroddsen, Ásdís: Ekki hrædd lengur. In: Helgarpósturinn, 22.12.1982, S. 6.
[3] RÚV, DB9213. Samtímaskáldkonur, 1.10.1985.
[4] Vgl. Morgunblaðið: Minningar [Todesanzeigen], 22.9.2020, S. 21.
[5] Vgl. [O.V.]: Íslenskir námsmenn undir eftirlit Stasi í Leipzig. In: Tíminn, 9.11.1991, S. 26.
[6] Vgl. Minningar, 22.9.2020, S. 21.
[7] Vgl. [O.V.]: Þýzk stúlka, búsett á Íslandi. In: Morgunblaðið, 14.12.1967, S. 17.
[8] Vgl. Minningar, 18.5.2013, S. 32.
[9] Vgl. Þjóðskrá Íslands: Auskunft an den Verfasser vom 31.1.2024. Der genaue Ort der Eheschließung darf gemäß deutscher Personenstandsgesetze nicht veröffentlicht werden.
[10] Vgl. Samtímaskáldkonur.
[11] In den „Bibliographischen Annalen“ wird Helga M. Novak mit zwei Publikationen geführt: Bei diesen handelt es sich aber zum einen um einen Beitrag in der inoffiziellen Zeitschrift „Zweite Person“ aus dem Jahr 1987 (vgl. Tanneberger, Horst/ Hillich, Reinhard: Literatur in der SBZ/DDR. Bibliographische Annalen 1945-1990. Begründet von Herbert Jacob. Berlin 2021, Bd. VI, S. 3471f.) und zum anderen um einen Abdruck in einem Lesebuch des Internationalen Deutschlehrerverbandes aus dem Jahr 1989 als gemeinschaftliche Herausgabe mit dem bundesdeutschen Langenscheidt-Verlag (vgl. ebd., S. 3614).
[12] Vgl. Minningar, 18.5.2013, S. 32.
[13] Vgl. BA MfS AP 1382/92, S. 25.
[14] Vgl. Sammlung Jacob nach Sächsischem Staatsarchiv Leipzig.
[15] Vgl. Forschungsplattform Literarisches Feld DDR: Helga M. Novak.
[16] Vgl. Alþingi: Lög 18/1966 um veitingu ríkisborgararéttar. 9. mál, lagafrumvarp 663, 30.4.1966.
[17] Vgl. ebd., 9. mál, nefndarálit 507, 19.4.1966.
[18] Vgl. RÚV, 015268-0010-01. Orð um bækur, 9.12.2012.
[19] Vgl. Minningar, 18.5.2013, S. 32.
[20] Vgl. Ásdís Thoroddsen.
[21] Vgl. [O.V.]: Þýsk skáldkona segist hafa unnið fyrir Stasi. In: Morgunblaðið, 7.11.1991, S. 20. – Dort auch Abdruck des Offenen Briefes.
[22] Vgl. BA MfS AIM 916/61 Bd. 1, S.14.
[23] Vgl. [O.V.]: Flýði land ásamt Íslendingi sem njósnað hafði um systurflokkinn. In: Morgunblaðið, 12.11.1991, S. 27.
[24] Vgl. Orð um bækur.
[25] Vgl. ebd.
Digitale Hermeneutik
Jüngst erschienen: Der Tagungsband „Digitale Hermeneutik: Maschinen, Verfahren, Sinn“ mit unserem Beitrag zum Thema „Visualisierung und Sinnstiftung: Repräsentation biographischer Daten“
(mehr …)Korpus Autor*innen in der DDR
Um ein literarisches Feld zu untersuchen, bedarf es einer möglichst umfassenden Bestandsaufnahme von Autor*innen. Im Rahmen unseres Pilotprojekts zu den Absolvent*innen des Instituts für Literatur „Johannes R. Becher“ Leipzig haben wir daher ein Korpus der Autor*innen bestimmt, die zwischen 1945 und 1990 in der SBZ/DDR – zumindest zeitweilig – lebten und schriftstellerisch tätig waren. Es umfasst knapp 3.400 Personen. Damit legen wir für die Literatur in der DDR eine Liste vor, welche den Anspruch auf strukturelle Repräsentation des gesamten Feldes erhebt, und stellen sie zur Diskussion. Kein Verzeichnis dieser Art wird jemals lückenlos sein. Bislang existiert allerdings keines, das auch nur annäherungsweise so umfassend ist wie das von uns hier vorgelegte. Für Ergänzungen, Korrekturen, Kritik, Hinweise und Fragen schreiben Sie uns bitte an info@ddr-literatur.de.
Im folgenden Dokument erläutern wir unsere Vorgehensweise bei der Bestimmung des Korpus, darunter finden Sie die Namensliste der Autor*innen.
Korpus-Autoren-in-der-DDR-Korpusbestimmung-Juli-2024Für eine größere Ansicht des Dokuments klicken Sie bitte hier.
Korpus-Autoren-in-der-DDR-Namensliste-Juli-2024Für eine größere Ansicht des Dokuments klicken Sie bitte hier (alternativ hier die Namensliste als Excel-Tabelle).
Datenschema und -modell
Im Folgenden stellen wir das im Projekt verwendete Datenmodell vor.
(mehr …)DDR-Literatur zum Hören
Im Folgenden weisen wir auf interessante Podcasts, Features und weitere Hörangebote zur Literatur in der DDR hin.
In der Podcastreihe „East Side Stories“ der Heinrich-Böll-Stiftung fragen Annette Maennel und Łukasz Tomaszewski: „Wie erinnern wir uns an die DDR?“ In zwei Folgen widmen sie sich dabei der Kinder- und Jugendliteratur in der DDR und wenig beachteten Autorinnen und Autoren, „die schon vor 1989 weder Konsens noch Kanon in der DDR waren und die heute auch nicht auf den „Bestsellerlisten“ stehen“.
Feature von Paul Kother im WDR zu den schreibenden Arbeiter*innen in der DDR und der BRD: „Schreibende Arbeiter – Fließband, Stift und Schreibmaschine„: „Wie sahen die verschiedenen Versuche in Ost- und Westdeutschland aus, Arbeiterinnen und Arbeitern zum Schreiben zu bringen? Welche Grenzen und Gefahren gab es? Warum gibt es die Bewegung nicht mehr und was sagt sie uns heute?“
Projektmitarbeiterin Birgit Dahlke im Literaturpodcast „Auf ein Buch!“ von Sebastian Aufdemkamp über Christa Wolf, die Aktualität ihrer Werke und „wie man junge Menschen heute für Christa Wolf und ihr Werk begeistern kann“.
„Auf den Spuren Christa Wolfs durch Berlin-Mitte“ . Marina Brafa und Emma Charlott Ulrich haben mit Unterstützung der Christa-Wolf-Gesellschaft einen Audio-Spaziergang über Leben und Wirken Christa Wolfs komponiert. An sechs Wohn- und Wirkorten der Wolfs in Berlin-Mitte erzählen sie „über den Alltag Christa Wolfs, ihr Schreiben, ihre Begegnungen und die Herausforderungen in ihrer Zeit. Und natürlich kommt die Autorin auch selbst zu Wort“. Zum Nachgehen und Hören.
Historische Biographik und kritische Prosopographie als Instrumente in den Geschichtswissenschaften
Im Sommer 2023 erschienen: Unser „Werkstattbericht zur prosopographischen Erfassung von Schriftsteller:innen in der DDR“ im Band „Historische Biographik und kritische Prosopographie als Instrumente in den Geschichtswissenschaften“.
(mehr …)Die DDR-Kinder- und Jugendliteratur der1970er Jahre aus bio-bibliographischer Sicht
Vortrag bei der Tagung “Kinder- und Jugendliteratur in der DDR – Die
1970er Jahre”, vom 07. bis 09. September 2023 an der Universität Potsdam (veranstaltet von den
Universitäten Gießen und Potsdam in Verbindung mit der Universität Stettin).
Der Bestand des Instituts für Literatur „Johannes R. Becher“ im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig
Marion Fechner vom Sächsischen Staatsarchiv stellt im Blog des Archivs den Bestand des Literaturinstituts und dessen Nutzung vor.
(mehr …)Aufklärung statt Verklärung: Die literarische DDR im Spiegel unserer Zeit.
Salonabend an der BBAW
Unter großem Andrang der interessierten Öffentlichkeit fand am Abend des 13.5.2023 in den Räumen der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften der Salon Sophie Charlotte mit dem diesjährigen Rahmenthema Aufklärung 2.0. statt. Neben Vorträgen, Diskussionen und Führungen war auch das Kooperationsprojekt Literarisches Feld DDR als Science Station mit einem breit gestreuten Programm vertreten: In Gesprächen mit der Redaktionsleiterin, Marianne Jacob, und einem Doktoranden wurde das Forschungsprojekt den Besuchern vorgestellt. Auf außerordentliches Interesse stießen dabei die durchgeführten Interviews mit den ehemaligen Absolventen des Literaturinstitutes Johannes R. Becher in Leipzig, welches Zeit seines Bestehens die einzige Ausbildungsstätte für Schriftsteller im deutschsprachigen Raum gewesen war. Getreu dem Motto des Salons folgend, konnte den Besuchern ein Bild der literarischen DDR im Spiegel unserer Zeit vermittelt werden, und zwar unter der Beachtung des literarischen Schaffens der Autoren und den politischen Erwartungen der DDR-Staatsführung. Aufklärung als Begriff erfuhr dabei einen völlig neuen Bedeutungsinhalt.
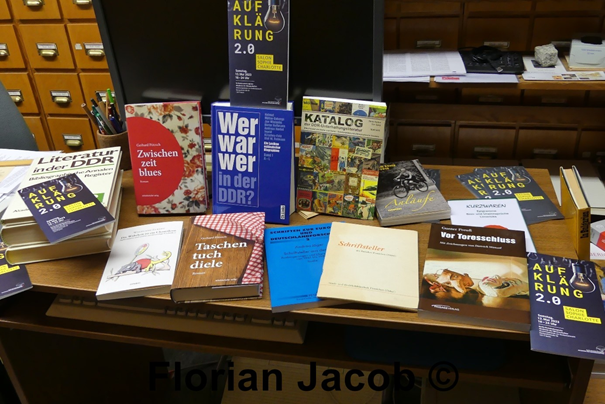
Foto: Florian Jacob
Die Gästefragen und Anregungen waren vielfältiger Natur; so kannte eine Besucherin weitere DDR-Autoren persönlich und bot Kontaktvermittlung an. Mehrere Anwesende äußerten sich über die Relevanz des Projektes für die Forschung, erkundigten sich nach einem Nachfolgevorhaben zu weiteren DDR-Schriftstellern sowie über die Quellenauswahl, wie z.B. die Bibliographischen Annalen und Archivanfragen. Eine gebürtige Ostpreußin interessierte sich für Autoren aus Ostpreußen und den anderen ehemaligen deutschen Ostgebieten sowie besonders für die Fragebogeninterviews (u.a. Egbert Lipowski). Die Ausbildung der Mitarbeiter am Forschungsvorhaben, die Sammlung Jacob und deren Digitalisierung waren ebenfalls für das Publikum von Interesse. Studenten der FU Berlin (mit einem ähnlichen Forschungsgebiet zu Persönlichkeiten der DDR) und Mitarbeiter der BBAW waren von den technischen Möglichkeiten der von Jörn Kreutel an der Berliner Hochschule für Technik entwickelten und am Salonabend in Auszügen erstmals vorgeführten Datenbank angetan, als probeweise Namens-, Orts- und Werktitelabfragen ermittelt wurden. Eine Lesebegeisterte der DDR-Literatur erzählte, dass sie sich mit der Biographie der deutsch-isländischen Autorin Helga Maria Nowak beschäftige. Mitglieder des Vereins Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin wollten Näheres zu Quellen- und Adressermittlung sowie dem Verlauf der Fragebogenaktion wissen. Ein Ehepaar fragte schließlich u.a. nach Berufen in der DDR-Zeit und möglichen Karrierebrüchen der Schriftsteller in der Wendezeit. Um Auskünfte zu Genderforschung im Projekt und der IM-Tätigkeit der Autoren bat eine Wissenschaftlerin aus Polen.
Der gelungene Abend zeigte einmal mehr die Relevanz der weiteren Forschung auf dem Gebiet der DDR-Literatur und birgt Vorfreude auf den kommenden Salon.
Autorin: Marianne Jacob