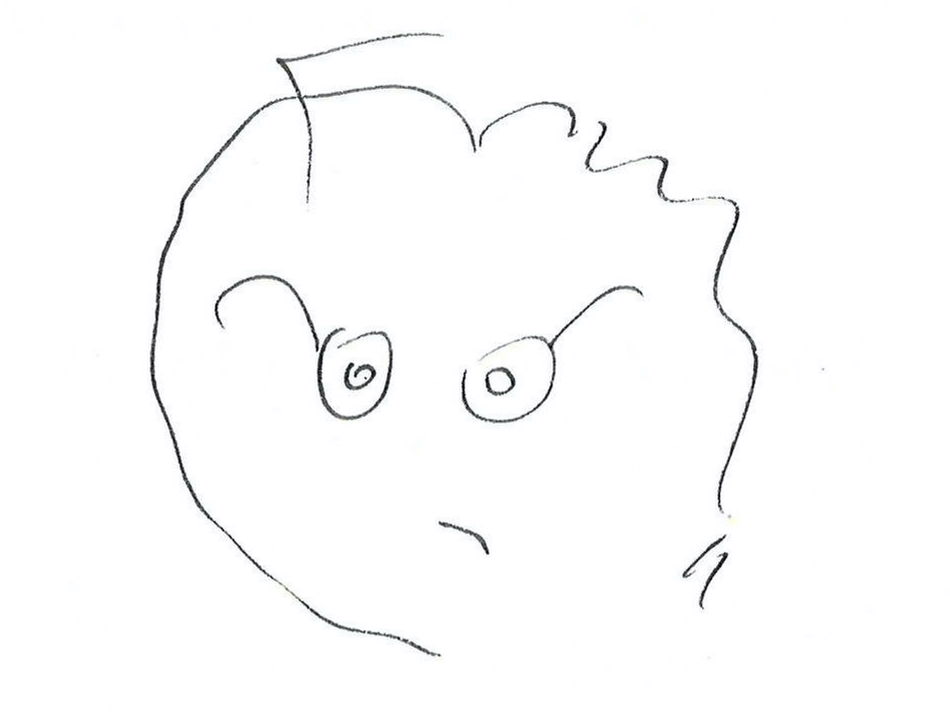
Thomas Rosenlöcher: Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern. Harzreise. Frankfurt a. M. 1991, S. 38.
Plötzlich allein hier zu stehn, war mir aber auch nicht recht. Eine Weile schaute ich in die Bode hinab und wartete auf ein Naturerlebnis. Aber kein Kräuseln schaute mich an. Und das Rauschen rauschte an meinem Ohr vorbei. Und meine Spucke zerstob unter dem Brückengestänge. Und selbst als ich der Spucke etwas mehr Gewicht beimengte, nahm das Wasser den Fladen beleidigend beiläufig auf. Jeder Bach im Fernsehn wäre wirklicher gewesen, weil jeder Bach im Fernsehn bunter und vielfach schäumender war. Warum hatte mich meine Frau nur in den Harz geschickt?
Die Frage des Erzählers bleibt unbeantwortet. Immer wieder wird er sie seiner Frau im Verlauf der Geschichte direkt oder indirekt stellen. Sie wird zum strukturierenden Element der Erzählung, ebenso bildet sie den Erzählanlass. Seite für Seite quält sich der Erzähler hinkend[1] durch eine Landschaft, die noch vor wenigen Monaten Grenzgebiet zweier deutscher Staaten war.
Als Reaktion auf den Mauerfall hatte Thomas Rosenlöcher seine Harzreise „Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern“ 1991 geschrieben. Seine narrative Instanz wird während ihrer Reise immer wieder mit den einstmals geltenden Realitäten der ehemaligen DDR konfrontiert. Am deutlichsten geschieht dies in einer Szene, in der das Ich die Grenze von Ost nach West überquert:
Ein Streifen Landschaft war beidseitig durch einen silbrigglänzenden Zaun abgetrennt. Aber ein Drahtsegment offen und innen entlanggehen möglich. Auf einer Betonplattenstrecke, immer rechts und links flankiert von diesem silbrigen, niemals rostenden Zaun. Nur manchmal ein Flachbunker. Und in kurvigem Schwung des über die Höhe gezogenen Streifens oben ein Vierkantturm mit kleinen, rechteckigen Fenstern. Der, wieder im Abschwung zur Senke hinunter, dem nächsten weißen Betonturm ins rechteckige Auge sah: und dies durch das ganze Land.
„Ich bin ein Arsch“, sagte ich.
Vor einem Jahr fünf Schritte hier, und ich läge am Zaun. Auf dem zur Spurensicherung und zu Verblutungszwecken stets krautfrei gehaltene Streifen, auf dem auch jetzt noch nichts wuchs. Und die deutschen Fichten beidseits besonders dicht bepelzt und vollkommen ununterscheidbar in ihrer naßgrünen Qualität.
„Ich bin ein Arsch“, sagte ich.
Aus einem Rechteckfenster zielte grinsend ein Kerl mit einem Stock auf mich. „Ich gehe hier nur spazieren“, sagte ich, schon im Gehen. „Ich wollte gar nicht nach dem Westen“, erklärte ich demonstrativ.
Thomas Rosenlöcher: Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern, S. 72.
Zusammen mit dem Dresdener Tagebuch „Die verkauften Pflastersteine“ (1990) und der Aufsatzsammlung „Ostgezeter. Beiträge zur Schimpfkultur“ (1997) bildet die „Harzreise“ eine Trias zur Zeitgeschichte. Die drei Bände, allesamt im Suhrkamp Verlag erschienen, begründeten die gesamtdeutsche Bekanntheit des am 29. Juli 1947 in Dresden geborenen Schriftstellers. Am 13. April 2022 ist Thomas Rosenlöcher im Alter von 74 Jahren in Kreischa gestorben und die zahlreichen Nachrufe im nationalen Feuilleton bezeugen ebendiese Bekanntheit.
In der „Zeit“ wird Rosenlöcher von Michael Braun als „Engel der Beharrlichkeit in der Gegenwartspoesie“[2], im „Tagesspiegel“ als „Chronist der Wendezeit“[3] und in der „FAZ“ als „Schöngeist“[4] bezeichnet. Was Rosenlöcher von diesen Benennungen gehalten hätte, bleibt offen, dass er nicht viel von einem zu starken Autor-Ich hielt, belegen seine Texte eindringlich. In der „Harzreise“ etwa destruiert er die Konzeption des wandernden Schriftstellers als Genie mit Bezug auf Goethe:
Goethe wäre. Aber das Grün war stumpfer geworden. […] Am Wegrand ein Baumstumpf. Auf dem Baumstumpf ein Unkenntliches, so daß der Stumpf als Postament des Unkenntlichen diente. Und als ich noch einmal umkehrte, eingehend das Phänomen zu betrachten. Und leider feststellen mußte, daß es ein Scheißhaufen war.
Thomas Rosenlöcher: Die Entdeckung des Gehens beim Wandern, S. 45f.
Humor und Feinsinn halten sich bei Rosenlöcher die Waage. Er war ein Arbeiter am Wort, der in seinen Gedichten tradierte Strophen- oder Versformen spielerisch zu nutzen wusste (vgl. bspw. „An die Klopapierrolle“[5]) und überdies sowohl kanonisierte Schriftsteller:innen (vgl. bspw. „Brockes“[6]) als auch zeitgenössische Dichter:innen[7] zu rezipieren verstand.
Bevor sich Rosenlöcher jedoch der Schriftstellerei in Vollzeit widmete, schlug er zunächst einen ganz anderen Berufsweg ein. Nach Abschluss der 10. Klasse an der POS absolvierte er eine Lehre zum Handelskaufmann, erwarb nach seinem Wehrdienst bei der NVA das Abitur und studierte Ökonomie an der Technischen-Universität in Dresden, um danach von 1974 bis 1976 im Holzhandel als Arbeitsökonom zu arbeiten. Mit mehrjähriger Berufserfahrung begann er bis 1979 in Leipzig am Literaturinstitut „Johannes R. Becher“ ein zweites Mal zu studieren. Anschließend war er als Dramaturg im Dresdener „Theater der Jungen Generation“ beschäftigt. Erst 1982, im Alter von 35 Jahren, veröffentlichte Rosenlöcher seinen ersten Gedichtband – „Ich lag im Garten bei Kleinzschachwitz“ –, für den er mit dem Debütpreis für Lyrik ausgezeichnet wurde. Dass er ab 1983 als freischaffender Schriftsteller leben konnte, verdankte er zahlreichen Preisen und Stipendien. Bereits vor 1990 bekam er den Georg-Maurer-Preis der Stadt Leipzig, danach u. a. den Erwin-Strittmatter-Preis (1996), den Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Tübingen (1999) und den Kunstpreis der Stadt Dresden (2002). Zuletzt wurde ihm 2017 die Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung verliehen.
Nach 1990 trat Rosenlöcher zunächst vor allem mit Essayistik und Prosa in Erscheinung, in den 2000er Jahren dann mit Geschichten für Kinder. Doch vor allem war er Lyriker. Sieben Gedichtbände umfasst sein lyrisches Oeuvre, das bereits früh positiv besprochen und ausgezeichnet wurde:
Zur Avantgarde zählt Rosenlöcher nicht. Er ist wohl ein Verblüffer, ein Schalk, ein Artist. Einer, der über seine Herkunft und – nicht zu vergessen – über seinen Tod räsoniert, aber auch einer, der Gedichte an seiner Nase, an Seife, an die Klopapierrolle, an die Zahnbürste riskiert. Er versteht es, sich kurz zu fassen, jedoch auch, ausschweifend zu sein – Zweizeiler gegen unstrophige Dreissig-und-mehr-Vers-Gedichte. Die Sonettformen riechen nach Übungs-, nach Schaustücken, dagegen die weniger formkünstlichen Predigt- und Erzähltexte gelingen unverwechselbar, und Tableau oder Deskription wechselt glückhaft mit Story und Traumbild, Stilleben oder Landschaft mit Vision.
Rainer Stöckli: Der Regenwurm, meine Damen und Herren. In: Neue Zürcher Zeitung vom 21. November 1989.
Zur Avantgarde zählte Rosenlöcher wirklich nicht, dagegen sträubt sich sein Werk, dagegen revoltierte sein Verständnis vom Schriftsteller. Als kritische Beobachter:innen der Gegenwart sollten sich Schriftsteller:innen verstehen – nur nie zu ernst, lieber ironisch. Seine „Harzreise“ ist aus dieser Perspektive geschrieben, ebenso die im Band „Ostgezeter“ versammelten Essays. So beispielsweise „Sächsisch als Verliersprache“: Im imaginären Zwiegespräch mit Grillparzer disputiert Rosenlöcher über den sächsischen Dialekt, um resümierend zu fragen – „Ist Lächerlichkeit nicht eine Form von Anmut?“[8]
Lächerlichkeit und Anmut – zwei Begriffe, die Rosenlöcher in seiner Kunst zu vereinen versuchte. Seine Gedichte sind gerade dann mehrdeutig zu interpretieren, wenn Selbstironie und Ernsthaftigkeit sich innerhalb eines Augenzwinkerns abwechseln. Besonders deutlich wird dies in Texten, in denen Rosenlöcher sein lyrisches oder narratives Ich hinkend auftreten lässt:
Dreissigstes Jahr
Da kommt ein Mensch im Schmuck der langen Haare
In: Thomas Rosenlöcher: Ich sitze in Sachsen und schau in den Schnee, S. 11.
und führt sein Lächeln, das berühmte, mit,
Fontänen springen auf vor seinem Schritt,
der Asphalt schwingt – er hat noch viele Jahre.
So weit so gut. Doch über ihm, zu Linken,
klirrt was, die Zeit. Er schüttelt seine Locken
und schwenkt den Arm, denn ein geheimes Stocken
befällt den Fuß. Ein unmerkliches Hinken
geht mit ihm mit. – Sieh an, der kommt nicht weit,
denk ich, da ich ihm lässig winke
und so vergessend, daß ich selber hinke,
auf ihn zugeh mit großer Leichtigkeit,
als ließ ich hinter mir den, der ich bin
und bin doch er. Hinkfüßig geh ich hin.
Wird noch in der ersten Strophe des Gedichts ein junger, vitaler Mensch veranschaulicht, kippt dieses Bild in der zweiten, denn „die Zeit klirrt“. Das Enjambement zum ersten Terzett des Sonetts ist nachfolgend hinter „Hinken“ gesetzt, was auf diesen Kippmoment hindeutet. Nicht mehr vital und jung, sondern gebrechlich kommt der beschriebene Mensch nun daher. Dass das lyrische Ich einen ähnlichen Prozess bei sich beobachtet, wird anschließend durch die Epiphora des Verbs „hinke“ verdeutlicht. In der letzten Strophe kommt es dann zu der verwirrenden Beobachtung des lyrischen Ichs – „der ich bin / und bin doch er“. Eine Einheit von Ich und Er wird konstatiert; es handelt sich sozusagen um eine Spiegelung des Ichs im Er. Belegt wird dies mit dem Satz: „Hinkfüßig gehe ich hin.“ Hier wird das Hinken des Ich verdoppelt, insofern das „hin“ am Vers- und Gedichtende als verbliebener Silbenrest von „hinken“ gelesen wird – es hinken zwei in einem.
Überdies kann in der „Harzreise“ das Hinken als Gegenbewegung zum programmatischen Titel verstanden werden. Sowohl das Wandern als auch das Gehen sind unbeschwerte Formen der Fortbewegung, das Hinken gerade nicht. Es widerspricht dem Erwartungshorizont, den der Titel evoziert, und symbolisiert wie im „Dreissigsten Jahr“ den Zustand des Alters. Die narrative Instanz in der Harzreise ist kein junges Genie, das während des Wanders poetische Erkenntnisse hat, sondern ein schon die vierzig Jahr überschrittener, hinkender, statt Poesie „Scheißhaufen“ findender Weihnachtsmann[9].
Es bleibt zu hoffen, dass das Werk Thomas Rosenlöchers weiterhin in all seinen Facetten – Witz, Ernst, Feinsinn und Reflexivität – gelesen und genossen wird.
Von Louisa Meier und Felix Latendorf
[1] „In Wernigerode ging ich zu einem Münzfernsprecher und telefonierte mit meiner Frau. ‚Ich habe aufgegeben.‘ / ‚Das kommt doch gar nicht in Frage.‘ / ‚Andauernd regnet es‘ / ‚Es hört auch wieder auf.‘ / ‚Du solltest mich mal hinken sehn.‘ / ‚Lieber nicht‘, sagte sie. / ‚Aber ich liebe dich.‘ / ‚Du bist doch erst zwei Tage fort.‘ / ‚Ach so‘, sagte ich. Dann hinkte ich wieder zum Bahnhof zurück […].“ (Rosenlöcher: Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern, S. 74)
[2] Michael Braun: Der Mittelpunkt der Welt liegt in Kleinzschachwitz, Zeit Online, 14. April 2022, https://www.zeit.de/kultur/literatur/2022-04/thomas-rosenloecher-dichter-poesie-lyrik-nachruf?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F.
[3] KNA: Chronist der Wendezeit. Thomas Rosenlöcher gestorben. In: Der Tagesspiegel vom 14. April 2022.
[4] Andreas Platthaus: Zum Tod von Thomas Rosenlöcher: Dresdenliebe kommt aus Dresdenverlust. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 13. April 2022.
[5] In: Thomas Rosenlöcher: Ich sitze in Sachsen und schau in den Schnee. 77 Gedichte. Frankfurt a. M. 1998, S. 31.
[6] In: Thomas Rosenlöcher: Das Flockenkarussell. Blüten-Engel-Schnee-Gedichte. Frankfurt a. M./Leipzig 2007, S. 10.
[7] Vgl. Sebastian Kiefer: „… und bei mir sprach: man muß bescheiden sein.“ [Rezension zu: Thomas Rosenlöcher: Ich sitze in Sachsen und schau in den Schnee]. In: Berliner LeseZeichen 2/99.
[8] Thomas Rosenlöcher: Ostgezeter. Beiträge zur Schimpfkultur. Frankfurt a. M. 1997, S. 13.
[9] „‚Aber Kinder‘, sagte sie. ‚Laßt doch den Wanderer in Frieden!‘ / ‚Das ist doch kein Wanderer‘, sagten die Kinder. ‚Das ist der Weihnachtsmann.‘“ (Rosenlöcher: Die Wiederentdeckung des Gehens beim Wandern, S. 60.)